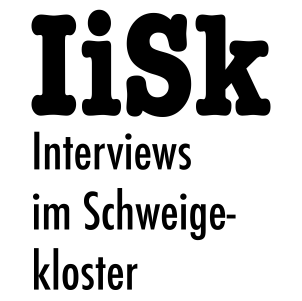Es war die erste Haselnussernte nach dem Zweiten Weltkrieg, die den jungen Konditor Luca Farrolo auf die Idee seines Lebens brachte: Er zerkleinerte die reifen Nüsse in einem Mörser so lange, bis sich eine süße Creme bildete, die er mit Kakao und Zucker mischte. Diese Kakao-Nuss-Creme strich er auf eine Waffel und fertig war ein typisch italienisches »Dolce«, welches gern zu einem Espresso oder als Dessert nach einem herzhaften Essen gereicht wurde.
Lucas Dolce hatte zunächst keinen Namen. Die Bewohnerinnen und Bewohner seines Heimatdorfes Calvari, in den kargen ligurischen Bergen gelegen, nannten es schlicht nach seinem Erfinder »Cioccolato di Luca«, daraus wurde schon bald die Kurzform »Ciolu« und aus »Ciolu« wurde ein Verkaufsschlager.
Nur zehn Jahre nach der Erfindung von »Ciolu« hatte Luca ein ganzes Imperium auf seiner Idee der Haselnuss-Kakao-Creme aufgebaut. Alle seine Kreationen bauten auf dem Prinzip dieser Creme in Verbindung mit einer Waffel auf: Creme zwischen zwei Waffeln, Creme zwischen Waffeln mit Schokoladenüberzug, Creme als Brotaufstrich und viele, viele Variationen mehr.
Es war im Jahr 1965, Italien war fest in Farrolos süßen Fängen, als Luca den Entschluss fasste ins Ausland zu expandieren. Deutschland schien ihm die richtige Wahl für sein Vorhaben zu sein: Die Teutonen haben sich nach dem Krieg zumindest wirtschaftlich gut entwickelt und mauserten sich langsam zu properen Konsumenten.
Ob diese Eisbein fressenden Banausen jedoch Gefallen an seinen Kreationen finden würden, bezweifelte er ernsthaft. Er erinnerte sich an die Erzählung eines Jugendfreundes, der vor einigen Jahren nach Deutschland gezogen war, um dort irgendwo in der regnerischen Einöde Autos mit Heckmotor zusammenzuschrauben. Diesen Schulfreund hatte Luca vor einigen Monaten nach der Ostermesse getroffen, und er erzählte von den merkwürdigen Gewohnheiten seiner deutschen Kollegen: die soffen den ganzen Tag Kuhmilch wie die kleinen Kälber! Zum Frühstück: Milch, zum Mittag: Milch, zum Abendbrot: Milch!
Luca reichte diese Einschätzung der deutschen Ernährungsgewohnheiten, um für den Markteintritt seine Produkte an den Zielmarkt anzupassen. Er kreierte eine Art Schokoladenriegel, der statt seines Dauerbrenners Haselnuss-Kakao-Creme eine fette Creme aus Milch, Butter und Zucker enthielt. Auch sprachlich wollte er den Produktnamen dem Zielmarkt anpassen: Sein Neffe Mateo lebte sein vielen Jahren in Südtirol und war der deutschen Sprache mächtig. Sie unterhielten sich über das Produkt, und wem es schmecken würde. Sie waren sich schnell einig, dass diese süße Verführung jedem Kind schmecken würde. Damit waren sie der Namensfindung aber kein Stück näher. Mateo schlug: „Ciolu für Kinder“ als Markennamen vor – Luca lehnte ab, denn das klang ihm dann doch zu deutsch. Trotzdem vergab er den Auftrag eine Verpackung zu gestalten, die Kinder ansprechen sollte. Die Designerin malte ihm zwei Milchkannen schwingende Kinder, einen Jungen und Mädchen, auf die Packung, die deutscher kaum hätten aussehen können: Der Junge blond, blauäugig und mit einer Lederhose, das Mädchen genauso blass, blond und blauäugig, in einem karierten Kleid und mit geflochtenen Zöpfen.
Luca bat erneut Mateo um Hilfe: Vielleicht würde ihm im Angesicht des stereotypen Nachwuchses die Idee für einen deutschen, aber nicht so sperrigen Namen kommen. Luca entfuhr sofort ein Wort: »KNIABIESLER« – nicht ahnend, dass diesen Begriff nördlich des Weißwurstäquators wohl niemand kennen oder ihn gar aussprechen könnte.
Long story short
Kniabiesler-Schokolade entwickelte sich zu einem Renner in Deutschland! Luca entwickelte verschiedene Darreichungsformen: als Tafel, kleine Riegel, große Riegel, als Hohlkörper mit einem Spielzeug in der Mitte – die Teutonen liebten die italienischen Spezialitäten, die viele wegen des Namens und der sehr deutsch aussehenden Kinder auf der Packung eher für eine bayerische, denn für eine italienische Spezialität hielten.
Die Nachfrage war so groß, dass Luca 1970 eine Produktionsstätte nördlich der Alpen errichten ließ. Die Stadt Wiesbaden erschien ihm als guter Ausgangspunkt, und das war sie auch! Zumindest für 25 Jahre – dann kam die Europäische Gemeinschaft, die für Industrieansiedlungen in strukturschwachen Regionen immense Fördergelder auslobte. So kam es, dass Luca im wallonischen Hennegau eine niegelnagelneue Fabrik baute, die ihn selbst dank der großzügigen Förderung nur ein paar Milliarden Lira kostete.
Die Fabrik war so groß und so modern, dass sie allen anderen Standorten Konkurrenz machte. Schon wenige Jahre später konzentrierte sich 2/3 der Farrolo-Produktion auf den Standort im Hennegau. Auch Luca selbst war regelmäßig dort zu Gast, nicht selten um irgendwelche Rekordergebnisse zu feiern.
Es war eine dieser Feiern, bei der Luca 275 silberne Probierlöffel an die Belegschaft verschenkte. Der junge Belgier Martin Dubois war erst wenige Monate bei Farrolo beschäftigt und sollte die Nachfolge des bald in den Ruhestand ausscheidenden Qualitätsmanagers Luc Leclerq übernehmen.
In der zweiten Dekade des neuen Jahrtausends stieg der Absatz weiter: ganz Europa konnte den Leckereien aus Lucas Fabriken nicht widerstehen. Zeitgleich stieg der Druck auf Farrolo: es gab immer mehr Nachahmer, die ihre Plagiate in Discount-Läden verramschten. Dieser Druck ging nicht spurlos am wallonischen Standort vorbei: es wurde Personal abgebaut, die Produktion wurde auf Effizienz getrimmt und lange Stillzeiten für Reinigung und Revision der Anlagen wurden auf ein absolutes Minimum reduziert.
Martin Dubois, der Qualitätsbeauftragte, der eigentlich mal den ehrbaren Beruf des Heizers erlernt hatte, und seine Karriere zu einem großen Teil dem Umstand verdankte, dass seine sehr attraktive Schwester eine sehr intime Beziehung zum Personalleiter der Farrolo-Fabrik pflegte, dieser Martin Dubois machte aber stets eines klar: An der Qualität der Produkte wird nicht gespart!
Für Dubois war Qualität das Synonym für Geschmack. Neumodische Errungenschaften der Lebensmittelüberwachung, wie mikrobiologische Untersuchungen, Hygienekonzepte oder dergleichen waren ihm fremd und deren Nutzen erschienen ihm zudem zweifelhaft. Etwas was gut schmeckt kann doch nicht schlecht sein! Und so war der silberne Probierlöffel sein ständiger Begleiter.
Seine These zur Relation zwischen Qualität und Geschmack wurde zudem durch den Umstand gestützt, dass der Leiter der zentralen europäischen Qualitätsüberwachung, der Deutsche Manfred Sickendieck – von allen Kollegen respektvoll nur »Dottore« genannt – nie weitere Anforderungen an Dubois Qualitätsstandards gestellt hat. Im Gegenteil! Sickendieck lobte: Die kosteneffiziente Umsetzung des Qualitätsmanagements am belgischen Standort sei herausragend.
Erst später sollte sich herausstellen, dass »Dottore« kein Biologe oder Veterinär ist – beides wäre im Aufgabenbereich der Lebensmittelüberwachung typisch – sondern gelernter Bankkaufmann und promovierter Betriebswirt. Er stand auch nicht der Abteilung »Qualitätsmanagement« vor, sondern dem »Controlling«. Aus eben diesem Begriff, rührte ein langanhaltendes und fatales Missverständnis: Sickendieck kontrollierte nicht die Qualität, sondern nur die Finanzen.
’s hat noch immer jot jegangen
Die Produktion lief rund um die Uhr – sieben Tage die Woche. Schon kurz vor Weihnachten begann man mit der Produktion der Sondereditionen zu Ostern. Geschmacklich war alles wie immer – Dubois war zufrieden.
Eines jedoch setzte ihm zu: Seine Gesundheit.
Während er normalerweise aufgrund des dauerhaften Schokoladenkonsums mit übelsten Verstopfungen kämpfte, hatte er plötzlich seit Tagen einen »flotten Otto«, wie er ihn sein Leben lang noch nicht hatte. In dieser Phase der Produktion wollte er sich aber auch keine Fehlzeiten leisten und setzte auf die Selbstheilungskräfte seines Körpers. Er sollte Recht behalten: Nach ein paar Tagen war der Spuk wieder vorbei.
Tag für Tag verließen in dieser Zeit Millionen von Schokoriegeln, Schoko-Eiern oder Schoko-Hasen die Fabrik.
Monate später, ein paar Wochen vor Ostern, war Martin Dubois gerade damit beschäftigt seine Sporttauben, die auf einem Leimbinder der Hallendachkonstruktion oberhalb der Kakao-Mischanlage nisteten, zu füttern, als sein Telefon klingelte. Es war ein Manager aus der italienischen Zentrale. Irgendwas sei mit »Salmonellen« und die Kinder würden krank davon – viel verstand er nicht davon, was der Mann ihm in gebrochenem Französisch erzählte. Martin gab dem Manager am anderen Ende der Leitung den Tipp, dass die Kinder dann lieber weniger von diesen »Salmonellen« essen sollten, wenn sie so schwer verdaulich seien. Fisch ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Es waren nur noch wenige Tage bis Ostern, Martin hatte die Sache mit der vermeintlichen Fischvergiftung in Italien längst wieder vergessen, als plötzlich die Polizei im Werk auftauchte: in ganz Europa saßen Kinder auf dem Donnerbalken und kackten sich die Seele aus dem Leib. In Deutschland gab es in den Supermärkten kein Toilettenpapier mehr und als Ursache dafür hat man diese Produktionsstätte ausgemacht. Martin Dubois wurde nach Hause geschickt. Er verstand die Welt nicht mehr.
Immerhin durfte er seine Tauben mitnehmen.